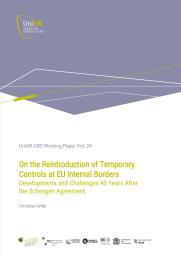Working Paper Vol. 26
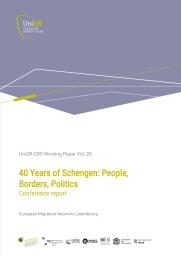
Anläßlich des 40. Jahrestags des Schengener Abkommens bot die Konferenz „40 Jahre Schengen: Menschen, Grenzen, Politik“, die vom EMN Luxemburg und dem UniGR-Center for Border Studies gemeinsam organisiert wurde, eine willkommene Gelegenheit, die europäische Integration zu feiern und die sich wandelnden Realitäten von Grenzregimen kritisch zu analysieren. Im Mittelpunkt stand die Freizügigkeit in Grenzregionen, insbesondere im SaarLorLux-Raum. Dabei wurden die sozioökonomischen Verflechtungen, rechtlichen und politischen Herausforderungen untersucht, die mit der Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen einhergehen. Die Panels und Diskussionsrunden beleuchteten die sich verändernden Dynamiken an den inneren und äußeren Rändern des Schengen-Raums. Dort tragen Migrationsbewegungen, sicherheitspolitische Diskurse und geopolitische Krisen zu einer beginnenden Neukonfigurierung des Schengen-Geistes bei. Die Teilnehmenden sprachen sich für ein erneuertes Bekenntnis zu den Grundwerten Solidarität, Vertrauen und geteilter Souveränität aus und betonten, daß die Zukunft Schengens politischen Willen und zivilgesellschaftliches Engagement erfordert. Die Konferenz bekräftigte, daß Schengen nicht nur eine gelebte Realität und ein Symbol europäischer Freiheit ist, sondern auch ein strategischer Grundpfeiler in Zeiten der Unsicherheit ist.